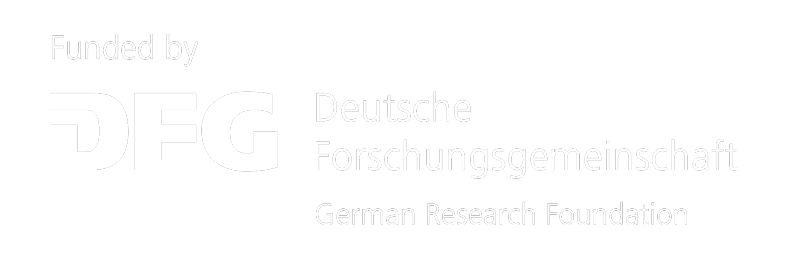Organisierter Gemeinsinn in Krisenzeiten: Vom freiwilligen Engagement zum sozialen Pflichtjahr?
Der Blogbeitrag ist eine stark gekürzte und bearbeitete Fassung des Beitrags: Silke van Dyk (2025): Vom freiwilligen Engagement zum sozialen Pflichtjahr? Wider eine allgemeine Dienstpflicht in Zeiten des Community-Kapitalismus, in: Alexander Dietz & Hermann Diebel-Fischer (Hrsg.), Umstrittene allgemeine Dienstpflicht, Berlin: LIT-Verlag, S. 25-42.
Die Gegenwart ist reich an Krisen und Krisenzeiten sind Zeiten, in denen Politiker*innen zuverlässig den gesellschaftlichen Zusammenhalt beschwören und das Engagement der Bürger*innen als Hoffnungsträger identifizieren. Dies gilt insbesondere angesichts der Sorgekrise, die nach Jahren wohlfahrtsstaatlicher Einschränkungen durch die gesellschaftliche Alterung, den Wandel der Geschlechterverhältnisse und den Fachkräftemangel forciert wird. Zumeist gilt der Ruf der Politiker*innen dem freiwilligen zivilgesellschaftlichen Engagement in Vereinen, Wohlfahrtsverbänden, Kirchengemeinden oder Initiativen. Es sind aber zunehmend auch Stimmen zu vernehmen, die den Zusammenhalt mit einem sozialen Pflichtjahr für junge Menschen sichern wollen. So betonte der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Zeitungsbeitrag vom 12. Juni 2022: “Gerade jetzt, in einer Zeit, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein. Man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen, hilft Bürgern in Notlagen. Das baut Vorurteile ab und stärkt den Gemeinsinn.” Auch der amtierende Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterstrich im beginnenden Wahlkampf im November 2024 die Bedeutung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres für die Stärkung des Gemeinwesens.
Die Problematik eines Pflichtdienstes liegt angesichts der Geschichte von Zwangsarbeitsdiensten und dem verfassungsrechtlichen Verbot von Zwangsarbeit auf der Hand. Erforderlich wäre eine Grundgesetzänderung, die den hohen Hürden für einen Pflichtdienst Rechnung tragen müsste, etwa durch eine starke Bildungsorientierung und partizipative Gestaltung. Engagementpolitische Expert*innen haben zudem eingewandt, dass die Freiwilligkeit inhärenter Bestandteil zivilgesellschaftlicher Initiativen sei, so dass sie nicht suspendiert werden könne, ohne den besonderen Charakter des Engagements zu zerstören. Umgekehrt betonen ehemalige Zivildienstleistende, die sich den Dienst nicht freiwillig ausgesucht haben, wie wichtig er für ihre persönliche Entwicklung und für die Auseinandersetzung mit neuen Lebenswelten war. Während der den Zivildienst ersetzende Bundesfreiwilligendienst ein Refugium eher privilegierter Jugendlicher geblieben ist und in den sorgenahen Feldern vor allem für junge Frauen attraktiv zu sein scheint, hätte ein sozialer Pflichtdienst den Vorteil, klassen- und geschlechterübergreifend zu mobilisieren und damit Begegnungen zu ermöglichen, die die regulären (Aus-)Bildungswege nicht bieten. Ich möchte dieses horizonterweiternde Potenzial nicht in Abrede stellen, in diesem Beitrag aber die möglichen Konsequenzen eines Pflichtdienstes für die Prekarisierung und De-Professionalisierung von Arbeit und Daseinsvorsorge in den Vordergrund stellen.
Der Kontext: Ein sozialer Pflichtdienst in Zeiten des Community-Kapitalismus
Die Herausgeber der soeben erschienenen Anthologie “Umstrittene allgemeine Dienstpflicht”, Alexander Dietz und Hermann Diebel-Fischer, sehen die Dienstpflicht als einen Garanten dafür, dass Staat und Gesellschaft im Krisenfall handlungsfähig bleiben. Sie betonen zwar, dass diese nur ein Baustein unter vielen sei und nicht als Antwort auf Sorgelücken und Fachkräftemangel missverstanden werden dürfe. Allerdings verzichten sie darauf, die politischen Maßnahmen zu diskutieren, die parallel zur Einführung eines Pflichtdienstes erforderlich wären, um eine instrumentelle Engführung als Ausfallbürgen eines auf Verschleiß fahrenden Sozialstaats zu verhindern. Es ist aber nicht primär eine Frage des guten Willens, ein soziales Pflichtjahr vor seiner instrumentellen Indienstnahme in Zeiten wachsender Versorgungslücken zu schützen. Es ist vor allem eine Frage der gesellschaftlichen Strukturen, die seit geraumer Zeit eine ebensolche Indienstnahme forcieren: Zu beobachten ist eine Neuinterpretation des Sozialstaatsgebots, die verstärkt auf neue, mehr oder weniger (in)formelle Hilfe-, Unterstützungs- und Verantwortungssysteme setzt. Im Lichte dessen ist eine Formation entstanden, die meine Kollegin Tine Haubner und ich “Community-Kapitalismus” nennen, und deren Verständnis förderlich ist, um die Kehrseiten einer sozialen Dienstpflicht auszuleuchten.
Freiwilliges Engagement fungiert im Community-Kapitalismus nicht nur als moralisches Fundament gesellschaftlichen Zusammenhalts, sondern auch als systemstabilisierende Ressource. Unbezahlte Arbeit und Fürsorgeleistungen – bis heute mehrheitlich von Frauen erbracht – sind das Lebenselixier kapitalistischer Gesellschaften: Einen Säugling zu einem lebensfähigen Menschen heranzuziehen, ist nicht profitabel – nach kapitalistischen Kriterien der Rentabilität – zu organisieren. In der jüngeren Vergangenheit sind zudem Dynamiken zu beobachten, die eine neue Verantwortungsteilung zwischen Staat, Markt, Familie und Zivilgesellschaft bedingen: Jahrzehnte der Privatisierung, Deregulierung und Kommodifizierung des Sozialsektors haben private und öffentliche Sorgekapazitäten erodieren lassen. Dies wird zusätzlich von zunehmenden Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen in der Arbeitswelt, einem Wandel der Familien- und Haushaltsstrukturen und neuen Bedarfen angesichts des demografischen Wandels vorangetrieben. In Zeiten zunehmender weiblicher Erwerbsbeteiligung schlagen sich diese Veränderungen in wachsenden Sorgeengpässen nieder, da Männer diese Sorgelücke nicht schließen. Vor diesem Hintergrund gewinnt informelle Arbeit jenseits regulärer, sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit außerhalb der Familie an Bedeutung. Die unbezahlte Arbeit der Familien, die noch immer das Gros der häuslich-informellen Pflege- und Sorgearbeit ausmacht, wird mithilfe staatlicher Anreizstrukturen um Freiwilligenarbeit ergänzt.
Diese Dynamik lässt sich als Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage beschrieben. Mit der Aktivierung der Zivilgesellschaft ist eine neue Erzählung über den Kapitalismus verbunden: Der Community-Kapitalismus trumpft mit dem Narrativ eines humaneren und sozialen Gegenwartskapitalismus auf, der sich mit der Betonung von Fürsorge und Wärme, Kooperation und gegenseitiger Hilfe um die Sicherung des sozialen Zusammenhalts bemüht – und seine Ungleichheit und Abhängigkeit stiftenden Kehrseiten de-thematisiert. Dass es sich nicht lediglich um ein Zusammenhalt stiftendes Miteinander, sondern auch um die (Aus-)Nutzung unbezahlter (oder aufwandsentschädigter) Arbeit in der Pflege, Kinderbetreuung oder Flüchtlingshilfe handelt, wird nicht zuletzt durch das Lob und die Sakralisierung von Engagierten als Engel und Helden verdeckt. Engel und Helden bewegen sich in Sphären jenseits vermeintlich profaner Fragen nach Geld, Arbeitsrechten oder Arbeitsmarktneutralität.
Es hat sich aber nicht nur die Nachfrage nach zivilgesellschaftlicher Daseinsvorsorge verändert. Auch auf der ‘Angebotsseite’ wird im Zuge von Individualisierungs- und Emanzipationsprozessen ein “Strukturwandel des Ehrenamts” diagnostiziert: Statt langjähriger Vereinsmitgliedschaft auf der Basis eines christlich-humanistischen Altruismus werden nun kurzfristige, zu den jeweiligen biografischen Lebensphasen passende Einsätze bevorzugt. Der Strukturwandel des Ehrenamtes und die zunehmende sozialpolitische Bedeutung des Engagements stehen dabei in einem Spannungsverhältnis: Auf der einen Seite Engagierte, die sich im Engagement flexibel und selbstbestimmt verwirklichen wollen; auf der anderen Seite eine zunehmende Nachfrage nach verbindlichem Engagement in sensiblen Bereichen wie der Altenpflege und Kinderbetreuung. Ein sozialer Pflichtdienst wäre eine Antwort auf diese Diskrepanz und würde auf eine – paradox anmutende – Verstaatlichung der Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage hinauslaufen.
Der Vorschlag für eine allgemeine Dienstpflicht revisited

Die partizipative Ausgestaltung eines Pflichtdienstes als Lernort gilt vielen Befürworter*innen sowohl als Bollwerk gegen eine Nähe zu Zwangsdiensten als auch als Instrument, um eine strategische Indienstnahme als Ausfallbürgen des Sozialstaats zu verhindern. Ungeklärt bleibt jedoch, ob der explizite Auftrag, als Krisenabsorber zu fungieren, nicht den individuellen Wünschen und Entfaltungspotenzialen der Dienstverpflichteten – und damit auch dem zweckfrei angelegten Bildungscharakter – im Zweifelsfall entgegensteht. Wenn beide Anliegen stark gemacht werden – Ressource zur Krisenbewältigung und partizipativ gestalteter Lernort –, muss auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass sie in Konkurrenz zueinander geraten.
Da der Charakter eines Pflichtdienstes mit der Frage steht und fällt, ob die jungen Dienstverpflichteten fehlendes professionelles Personal substituieren und ohne Ausbildung zu Stützen der Daseinsvorsorge werden, ist die Frage der Zusätzlichkeit und Arbeitsmarktneutralität des Dienstes von herausragender Bedeutung – doch genau dazu gibt es keine rechtssichere Regulierung.
Es ist ein grundsätzliches Dilemma von sozialem Engagement zu beobachten: Es soll einerseits ‘zusätzlich’ sein und keine Erwerbsarbeit substituieren, andererseits wird es als produktive Ressource adressiert, die zur Entlastung von Hauptamtlichen beitragen soll. “Wirklich zusätzliche ehrenamtliche Arbeitsbereiche können die Hauptamtlichen bei ihrer Tätigkeit [aber] nicht entlasten und umgekehrt ist ehrenamtliches Engagement, das Hauptamtliche entlastet, nicht wirklich zusätzlich.” (BMFSFJ 2015, S. 245). In der Praxis, so die Studie des für Engagement zuständigen Ministeriums BMFSFJ, wurde zumeist der Entlastungsfunktion des Engagements der Vorrang gegeben.
Da die aktuellen Vorschläge für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr alle jungen Menschen – und damit auch die historisch vom Wehr- und Zivildienst befreiten Frauen – adressieren, spielen geschlechtsspezifische Argumente eine wichtige Rolle. Fakt ist, dass trotz zunehmender Frauenerwerbstätigkeit und des Ausbaus öffentlicher Kinderbetreuung Frauen weiterhin einen Großteil der unbezahlten Sorgearbeit übernehmen. Aus diesem Grund käme ein Pflichtdienst für viele Frauen einer doppelten Belastung mit unbezahlter Arbeit gleich. Die in der Debatte von Alexander Dietz und Hartwig von Schubert aufgeworfene Idee, dieses Problem dahingehend zu lösen, für alle Geschlechter “individuelle Erziehungs- und Pflegeleistungen als Surrogat zur Erfüllung der Dienstpflicht bzw. als Freistellungsgrund anzuerkennen”, kann nicht überzeugen. Erstens wissen wir aus der Care-Forschung, wie schwer es ist, individuelle Sorgezeiten innerhalb von Haushalten zuverlässig zu erfassen. Zweitens müsste aus Gerechtigkeitsgründen ein Umgang damit gefunden werden, dass viele den Dienst bereits geleistet haben werden, bevor sie Sorgeverantwortung für Kinder (oder Eltern) übernehmen. Drittens scheint hier ein problematischer pro-natalistischer Zungenschlag auf: So formulieren Dietz und Schubert die Hoffnung, dass eine solche Anerkennung frühe Familiengründungen befördern würde; implizit lauert hier aber auch die Frage, ob eine allgemeine Dienstpflicht, die familiäre Sorge als Alternative akzeptiert, nicht vor allem auf eine gesellschaftliche Verpflichtung Kinderloser hinauslaufen würde. Und nicht zuletzt unterminieren die Autoren mit diesem Vorschlag ein zentrales Argument ihres Plädoyers für eine Dienstpflicht: dass sich ALLE jungen Menschen, unabhängig von Klasse und Geschlecht hier zusammenfinden und der Wert ihres Engagements gerade in seinem öffentlichen Charakter liegt.
Last but not least flüchten sich die Autoren in der Frage, ob ein Pflichtdienst Gefahr läuft, zum Zwangsdienst zu werden, in eine salomonische Formel, die das Problem umschifft. Wörtlich heißt es zum Charakter des Dienstes, “dass es nicht darum geht, dass der Staat gesellschaftliche Probleme durch Zwang lösen oder die selbstbestimmte Planung seiner Bürger beschneiden möchte, sondern darum, dass wir erkennen, dass wir selbst ‘der Staat’ sind.” (bei Dietz und Schubert S. 209). Hier möchte ich ein doppeltes ‘Nein!’ entgegnen: Erstens ist es eine Tatsache, dass ein Pflichtdienst die selbstbestimmte Planung seiner Bürger einschränkt, auch wenn es natürlich gute Gründe für eine solche Einschränkung geben kann, wie im Fall der Schul- oder Steuerpflicht zu sehen ist. Zweitens sind ‘wir’ nicht der Staat. Eine solche Einebnung von Staat und Zivilgesellschaft ist nicht nur demokratiepolitisch problematisch; sie verstellt zudem den Blick auf die Schlüsselfrage, welche Aufgaben in staatlicher Verantwortung als soziale Rechte gewährleistet werden sollen und wo die Eigeninitiative der Bürger*innen gefragt ist. Eine Verstaatlichung der Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage durch eine allgemeine soziale Dienstpflicht stellt im Lichte dessen keine win-win, sondern eine loose-loose-Konstellation dar: eine instrumentelle Durchstaatlichung der Zivilgesellschaft, die ihre Kritik- und Protestfunktion gefährdet und zugleich fundamentale soziale Rechte zu unterminieren droht.
Zitiervorschlag: van Dyk, Silke: “Organisierter Gemeinsinn in Krisenzeiten: Vom freiwilligen Engagement zum sozialen Pflichtjahr?”, Freiwilligkeit: Geschichte | Gesellschaft | Theorie, Juli 2025, https://www.voluntariness.org/de/organisierter-gemeinsinn-in-krisenzeiten/